1942: „Casablanca“ kommt in die amerikanischen Kinos
von Mirko Gründer
Am 26. November 1942 wurde eine der größten Hollywood-Legenden geboren: „Casablanca“ feierte Premiere in New York. Der Film machte Humphrey Bogart und Ingrid Bergman zu Stars – und heizte die Propagandamaschine der USA im Zweiten Weltkrieg an.

Humphrey Bogart wurde mit dem Propaganda-Streifen „Casablanca“ 1942 endgültig zum Star.
Dieser Film gibt viele Rätsel auf. Eines der größten ist, wie er 70 Jahre nach seiner Uraufführung noch so viele Menschen faszinieren kann. Umberto Eco stellte sich 1975 eben diese Frage und kam zu dem Schluss, dass „Casablanca“ einfach alles enthält: strahlende Helden, schöne Frauen und finstere Schurken, Drama und Romantik, starke Charaktere und Abenteuer, Musik und Action, haufenweise tragische Wendungen – und natürlich Politik.
„Casablanca“ war ein Propagandafilm. Als er am 26. November 1942 in die Kinos kam, waren die Vereinigten Staaten seit einem Jahr im Krieg. Präsident Franklin D. Roosevelt hatte lange daran gearbeitet, seinem Volk die Notwendigkeit eines Kriegseintritts deutlich zu machen. Er konnte sich dabei der Unterstützung weiter Kreise in Hollywood sicher sein. Jack Warner, der mit seinen Brüdern 1923 Warner Bros. gründete und es zu einem der erfolgreichsten amerikanischen Filmstudios machte, hatte schon Ende der 30er Jahre begonnen, mit Filmen Stimmung gegen Nazideutschland zu machen. Mit „Ich war ein Spion der Nazis“ brachten die Warners im Mai 1939 den ersten echten Anti-Nazi-Film in die amerikanischen Kinos. Zu diesem Zeitpunkt gaben 97 Prozent der US-Bürger in Umfragen an, dass sich ihr Land aus dem in Europa drohenden Krieg heraushalten sollte.
Ein Film, um den Faschismus zu bekämpfen
Jack Warner beschreibt in seiner Autobiografie, wie sehr ihn 1936 die Ermordung des deutschen Verkaufsleiters von Warner Bros. Philip Kauffman durch Nazi-Sturmtruppen in Berlin getroffen hat. Den Warners, die selbst jüdischer Abstammung waren, war die antisemitische Politik Hitlers nur zu bewusst. Zahllose Emigranten fanden Aufnahme und Beschäftigung in ihrer Filmmaschinerie und stellten sich in den Dienst der Kino-Propaganda.
Im Februar 1942 – kurz nach dem Kriegseintritt der USA – engagierte Warner die ebenfalls jüdischstämmigen Zwillinge Julius und Philip Epstein, damit sie aus dem bis dahin nie aufgeführten Theaterstück „Everybody Comes to Rick’s“ ein Drehbuch verfassten. Laut Anweisung der Produzenten sollte der Film zeigen, „dass persönliche Wünsche der Aufgabe, den Faschismus zu besiegen, unterzuordnen sind“.
Parallel wurde das Team für einen Film zusammengestellt, mit dem dem Publikum die Situation im Weltkriegs-Europa nähergebracht werden sollte. Wichtige Schlüsselrollen wurden von Emigranten eingenommen: Die Regie übernahm der ungarische Jude Michael Curtiz, der seit 1926 für Warner arbeitete. Die Schwedin Ingrid Bergman erhielt die weibliche Hauptrolle. Die Nebendarsteller Paul Henreid, Conradt Veidt und Peter Lorre waren aus Deutschland geflohen.
Casablanca als Sammelpunkt der Entwurzelten
Die international zusammengewürfelte Besetzung trug viel zur Authentizität des Szenarios bei. Die Stadt Casablanca im französisch besetzten Marokko war zum Zeitpunkt der Handlung ein abenteuerlicher Ort: Kontrolliert vom französischen Vichy-Regime, das mit den Nazis kollaborierte, gehörte sie zum Einflussbereich Nazideutschlands. Doch sie war weit genug von Berlin entfernt, um für Flüchtlinge attraktiv zu sein, und galt zudem als Sprungbrett in die Sicherheit der Vereinigten Staaten.
Entsprechend gespannt ist die Atmosphäre in der Stadt, wo der französische Polizeichef zwischen den Großmacht-Ansprüchen der deutschen Vertreter und dem Selbstbewusstsein seiner Landsleute im Widerstandkampf einen ständigen Eiertanz aufführen muss. Hier treffen die Parteien fast gleichberechtigt aufeinander, wie es besonders deutlich in jener Szene aufscheint, als die deutschen Offiziere in Rick’s Café Américain die „Wacht am Rhein“ anstimmen, um umgehend von den Einheimischen lautstark mit der „Marseillaise“ niedergesungen zu werden.
Die entscheidende Botschaft des Films an sein zeitgenössisches amerikanisches Publikum lag jedoch vor allem im moralischen Dilemma von Rick Blaine selbst: Der zynische Amerikaner, der sich zunächst aus allen Konflikten heraushalten und sich nur um seinen eigenen Vorteil kümmern will, erkennt schließlich, dass seine eigenen Probleme „in dieser verrückten Welt völlig ohne Belang sind“. Er ergreift Partei gegen die Nazis – und Warner Bros. opferte für diese Botschaft sogar das Happy End, auf das das Publikum sehnsüchtig wartet.
Ricks Beispiel und Amerikas Beitrag
Als „Casablanca“ in die Kinos kam, stiegen die Vereinigten Staaten gerade ernsthaft auf dem europäischen Kriegsschauplatz ein. Am 8. November, 18 Tage vor der Premiere, landeten 35.000 amerikanische Soldaten unter General Patton in der Nähe von Casablanca, um den britischen Afrikafeldzug zu unterstützen. Am 10. November besetzten sie die Stadt.
Nicht zuletzt durch die parallelen Ereignisse auf dem marokkanischen Kriegsschauplatz und das im Januar 1943 just in Casablanca stattfindende Treffen zwischen Roosevelt und Churchill wurde der Film ein großer kommerzieller Erfolg und erhielt 1943 drei Oscars.
Im Nachkriegsdeutschland kam der Film 1953 in die Kinos. Mit der Nazivergangenheit wollte man die Zuschauer allerdings nicht konfrontieren. Der Film wurde um 24 Minuten gekürzt und durch die Synchronisation umgedeutet. Major Strasser war so völlig aus der Handlung entfernt worden, aus dem Widerstandskämpfer Laszlo wurde ein norwegischer Wissenschaftler namens Larssen. Erst 1975 wurde eine vollständige und angemessen synchronisierte Fassung von der ARD gezeigt.


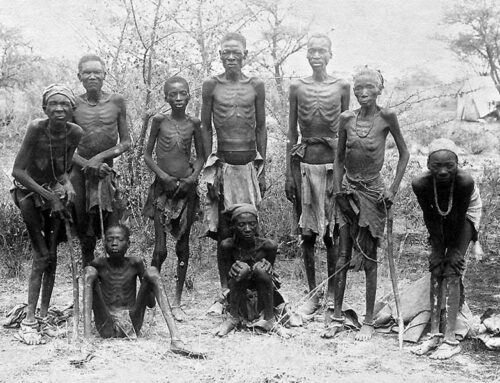
Hinterlasse einen Kommentar