Der Kaschmir-Konflikt
von Mirko Gründer
Kaschmir im Nordwesten Indiens besticht mit traumhaften Landschaften, ist aber seit über 70 Jahren das gefährlichste Pulverfass der Welt. Nirgendwo sonst stehen drei Atommächte nervös bereit, in einen alles vernichtenden Krieg einzutreten.

Paschtunische Stammeskrieger im Kaschmir, 1947.
Die Region Kaschmir liegt im äußersten Nordwesten Indiens und ist heute grob in drei Teile geteilt: Der größte, südliche Teil steht unter indischer Verwaltung, der nordwestliche unter pakistanischer und der Osten wird von China besetzt. Eine unruhige “Waffenstillstandslinie” trennt diese Teile voneinander und ist immer wieder Schauplatz von Auseinandersetzungen der drei Atommächte.
Indien erhebt Anspruch auf die gesamte Region, Pakistan beansprucht den indisch besetzten Teil für sich, hat allerdings die chinesischen Ansprüche im Osten anerkannt. Seit Beginn des Konfliktes gab es fünf ausgewachsene Kriege um die Region sowie ungezählte Scharmützel. Nichts deutet darauf hin, dass sich die Konfliktlage im 21. Jahrhundert bessern würde, im Gegenteil: Zwischen den Parteien herrscht weitgehend diplomatische Funkstille, Vermittler sind nicht in Sicht, und die Spannungen in der Region eskalieren weiter.
1947: Der Maharaja ist unschlüssig
Die Wurzeln des Konfliktes liegen in der Kolonialzeit und der Art, wie die Unabhängigkeit Britisch-Indiens 1947 organisiert wurde. Die größte Kolonie des Empires stand nur zu 52 Prozent unter direkter Herrschaft der Briten. Der Rest wurde von einheimischen Fürsten regiert, die mit unterschiedlichen Graden von Autonomie unter britischer Aufsicht agierten. Zum Zeitpunkt der Unabhängigkeit 1947 gab es 565 dieser Fürstenstaaten, viele davon waren winzig.
Das Fürstentum Kaschmir-Jammu war mit seinen ca. 219.000 Quadratkilometern Fläche das größte, mit seiner Einwohnerzahl von 4,2 Millionen das drittgrößte dieser Gebiete. Die Bevölkerung war, wie im ganzen Nordwesten Britisch-Indiens, überwiegend muslimisch, wurde jedoch von dem hinduistischen Maharaja Hari Singh regiert.
Der Fürst stand 1947 vor einer kniffligen Entscheidung. Britisch Indien sollte geteilt werden: In ein überwiegend muslimisches Pakistan, dessen am Ost- und Westrand gelegenes Staatsgebiet durch ein riesiges, überwiegend von Hindus bewohntes Indien getrennt wurden. Kaschmir lag an der Grenze des westlichen Pakistan und Indiens und musste sich entscheiden, welchem Staat es sich anschließen wollte.
Die Stimmung zwischen Muslims und Hindus war extrem aufgeheizt in diesen Jahren, Gewalt zwischen den Gruppen war längst an der Tagesordnung. Der Maharaja stand sowohl der sozialistisch orientierten Kongresspartei Gandhis und Nehrus als auch der aggressiven Muslimliga, die in Pakistan den Ton angab, skeptisch gegenüber. Er versuchte zunächst einen dritten Weg, indem er sein Fürstentum als unabhängige Macht zwischen den beiden neuen Staaten zu halten versuchte.
Der Kampf um Kaschmir beginnt
Weder Indien noch Pakistan waren geneigt, diesen dritten Weg zu akzeptieren. Die indischen Führer starteten eine Charmeoffensive. Gandhi begab sich im August 1947 persönlich nach Kaschmir, um für den Anschluss an Indien zu werben. Jawaharlal Nehru, Premierminister des unabhängigen Indien, betonte öffentlich, dass die Entscheidung der kaschmirischen Bevölkerung ausschlaggebend sein sollte.
In Pakistan entschied man sich für eine andere Herangehensweise. Die neue Regierung in Karatschi (die heutige Hauptstadt Islamabad wurde erst 1958 gegründet) motivierte die im Grenzgebiet von Pakistan und Afghanistan lebenden Stämme der Paschtunen, im Kaschmir einzufallen und so einen Anschluss an Pakistan zu erzwingen. Der Maharaja sah sich an die Wand gedrückt, da sich ein Großteil seiner muslimischen Beamten mit der Invasion solidarisierten, und bat in Delhi um Unterstützung. Am 26. Oktober 1947, nur vier Tage nach der paschtunischen Invasion, erklärte Hari Singh in bedrängter Lage den Beitritt seines Fürstentums zu Indien.
Einen Tag später rückten indische Truppen in die Region ein und drängten die Paschtunen zurück. Aber auch pakistanisches Militär wurde bald darauf in Bewegung gesetzt, denn die Führung in Karatschi weigerte sich, den Beitritt Kaschmirs zu Indien zu akzeptieren. Ab Frühjahr 1948 war so, ohne echte Kriegserklärung, der Erste Indisch-Pakistanische Krieg in vollem Gange.
Der eingefrorene Konflikt
Die Inder eroberten im Verlauf des Jahres 1948 im wesentlichen jenen Teil der Region zurück, der noch heute von ihnen kontrolliert wird. Im Januar 1949 endete der Krieg mit einem von den Vereinten Nationen vermittelten Waffenstillstand, der den Konflikt entlang der gerade bestehenden Frontlinien einfror.

Die Region Kaschmir inklusive heutiger faktischer Landesgrenzen.
Ein Zustand, an dem sich bis heute kaum etwas geändert hat. Pakistan hält die westlich und nördlich der „Line of Control“ genannten Waffenstillstandlinie liegenden Gebiete, die etwa ein Drittel des ehemaligen Fürstentums ausmachen, und Indien den Rest. Beide Seiten erheben Anspruch auf das gesamte Gebiet und zeigen wenig Willen, Kompromisse einzugehen. Eine Volksabstimmung, die die UN schon 1949 forderte, wurde von beiden Seiten abgelehnt.
Integration vs. Souveränität
Die folgenden Jahrzehnte waren einerseits geprägt vom Konflikt Pakistan-Indien, der nicht allein in der Kaschmir-Frage ausgetragen wurde, aber auch von den Versuchen Indiens, eine echte Integration des Fürstentums in die indische Republik zu erreichen. Diese Versuche stießen auf teils vehemente Widerstände vor Ort.
1947 hatte Nehru den Kaschmiris weitgehende Autonomierechte zugestanden, die 1950 auch Bestandteil der indischen Verfassung wurden. Abgesehen von Außen- und Verteidigungspolitik sollte sich der neue Bundesstaat weitgehend selbst regieren, Nicht-Kaschmiris war der Grunderwerb untersagt. Ab 1952 hatte Kaschmir als einziger indischer Bundesstaat eine eigene Verfassung und eine eigene Flagge sowie in dem ehemaligen Maharaja Karan Singh sogar ein eigenes Staatsoberhaupt.
Nehrus Hoffnung, so die Integration Kaschmirs in ein einheitliches Indien zu fördern, erfüllte sich nicht. Stattdessen gerieten die indische und kaschmirische Führung immer wieder in Konflikte, die erstmals 1953 in der Absetzung und Verhaftung des kaschmirischen Premiers Scheikh Abdullah kulminierten, der auf einer Souveränität des Kaschmir innerhalb Indiens bestand. Die Führung in Delhi versuchte in der Folgezeit, die praktische Autonomie Kaschmirs so gering wie möglich zu halten. Spannungen blieben an der Tagesordnung.
Ein neuer Player: China
In den fünfziger Jahren trat zudem ein neuer Akteur in das ohnehin schon explosive Gleichgewicht im Kaschmir ein. Die Chinesische Volksrepublik hatte nach der Besetzung Tibets 1950 begonnen, die rückständigen Gebiete durch Straßenbauten zugänglicher zu machen. Dabei führte eine neue Straße durch ein Gebiet, das nach indischer Sichtweise zum Bundesstaat Kaschmir-Jammu gehörte.
Es ist ein deutliches Zeichen dafür, wie abgelegen und unzugänglich diese Himalaya-Regionen sind, dass der Bau der Straße in Delhi erst einige Zeit nach Fertigstellung bemerkt wurde. Das machte den Konflikt um das umstrittene Grenzland jedoch nicht weniger intensiv. Am 20. Oktober 1962 drangen chinesische Streitkräfte in das von China beanspruchte Gebiet vor und besetzten es, ohne das überforderte indische Truppen vor Ort dies verhindern konnten. Schon einen Monat später beendete die chinesische Führung einseitig diesen Indisch-Chinesischen Grenzkrieg mit einem Waffenstillstand.

Heutige faktische Aufteilung der Region Kaschmir auf Pakistan, Indien und China.
So war auch der bergige Osten Kaschmirs durch eine Waffenstillstandslinie abgetrennt. Auch hier hat sich an der groben Konfliktlage seither wenig geändert: China und Indien beanspruchen das besetzte Gebiet, das von China verwaltet wird.
Neue Stärke Pakistans?
Pakistan war seit 1958 eine Militärdiktatur und rüstete mit Hilfe der USA weiter auf, um mit Indien gleichzuziehen. Die indische Niederlage gegen China 1962 sowie das Machtvakuum nach Nehrus Tod 1964 weckten bei den Machthabern in Islamabad Hoffnungen auf eine Schwächephase des Nachbarn. 1965 war es so weit: Ähnlich wie 1947 bildeten paramilitärisch propakistanische Einheiten die Speerspitze. Muslimische Mujaheddin rückten nach Kaschmir ein und versuchten, eine allgemeine muslimische Revolte anzuzetteln.
Indische Truppen drängten die Mujaheddin zurück und drangen über die Waffenstillstandslinie von 1949 hinaus auf pakistanisch besetztes Gebiet vor, was den Konflikt endgültig in den Zweiten Kaschmirkrieg verwandelte. Am 6. September 1965 erklärte Indien offiziell den Krieg und fiel auf breiter Front in Pakistan ein. Im Punjab kam es zu heftigen Auseinandersetzungen, unter anderem zur größten Panzerschlacht seit Ende des 2. Weltkriegs.
Nachdem sich der indische Vormarsch jedoch schnell festfuhr, einigten sich beide Seiten unter UN-Vermittlung auf einen weiteren Waffenstillstand. Der Vorkriegszustand wurde sowohl an der Staatsgrenze als auch im Kaschmir wieder hergestellt.
Außenpolitische Entspannung
Ende der 60er Jahre geriet Pakistan in schwere Krisen, die 1971 in der Abspaltung Ostpakistans kulminierten. Der neue Staat Bangladesh entstand. Indien hatte die Unabhängigkeit des Landes stark gefördert und es in seinem „Befreiungskrieg“ militärisch unterstützt, um Pakistan zu schwächen.
Die Strategie schien aufzugehen, denn zum ersten Mal seit 1947 beruhigte sich die Lage zwischen den Kontrahenten etwas. 1972 wurde sogar ein Vertrag geschlossen, in dem die Waffenstillstandslinie – nun „Line of Control“ genannt – im Kaschmir klar definiert wurde und beide Seiten sich auf eine friedliche Konfliktlösung verpflichteten. Neben diesen Entspannungsinitiativen trug auch die Tatsache, dass beide Länder seit den frühen 70er Jahren über Atomwaffen verfügten, zu mehr Besonnenheit im Umgang miteinander bei.
Innere Kapitulation
Für die innere Lage im Kaschmir bedeutete die außenpolitische Entspannung nichts Gutes. Indien hatte endgültig die Oberhand gewonnen und weniger denn je das Gefühl, auf die Autonomie des Kaschmir Rücksicht nehmen zu müssen. Premierministerin Indira Gandhi lehnte die noch immer bestehende Forderung nach einer Volksabstimmung über die staatliche Zugehörigkeit des Kaschmir ab. Kaschmir sei, so die damalige und noch heutige Floskel, ein integraler Teil Indiens und würde es immer sein.
Selbst die kaschmirischen Nationalisten schienen einzulenken. Der Volksheld Sheikh Abdullah, der 1953 von den Indern verhaftet worden war, einigte sich mit Indira Gandhi und durfte 1975 als Regierungschef in den Kaschmir zurückkehren. Die alte Nationalbewegung im Kaschmir hatte kapituliert.
Neue Konfliktlinien
Die relative politische Stabilität der siebziger und achtziger Jahre verdeckt die langsame erneute Zuspitzung der inneren Lage im Kaschmir. Neben den alten Konflikten mischte sich nun auch der Aufstieg des internationalen Islamismus und der Krieg im direkt benachbarten Afghanistan in die Lage. Als dieser Krieg im Februar 1989 durch den Abzug der sowjetischen Truppen beendet wurde, sickerten Mudjaheddin über die Grenze in den Kaschmir – möglicherweise unter tatkräftiger Unterstützung Pakistans.
Noch 1989 brach der Aufstand gegen die als Fremdherrscher wahrgenommene indische Regierung aus. Kaschmir wurde binnen kurzer Zeit in ein Bürgerkriegsgebiet verwandelt und blieb es für mehr als ein Jahrzehnt. Die instabile politische Lage in Delhi, wo 1989 die mächtige Kongresspartei ihre Regierungsmehrheit verlor, begünstigte das Chaos. 1990 erklärte die Regierung in Delhi den Notstand im Kaschmir und riss die direkte Regierungsgewalt im Bundesstaat an sich, die sie bis 1996 behielt.
Die seit 1996 wieder eingesetzte Regierung des Bundesstaates wurde von einem Teil der muslimischen Bevölkerung stets als Marionette Indiens und illegitim wahrgenommen. Indien hielt die Region mit einem strikten Besatzungsregime unter Kontrolle, das vielfach als Fremdherrschaft wahrgenommen wurde.
Islamistischer Terrorismus aus Kaschmir
Ab den späten 90er Jahren griff der innere Konflikt Kaschmirs zunehmend nach Indien aus. Terroranschläge der im Kaschmir aktiven islamistischen Gruppen erschütterten das Land, so am 13. Dezember 2001 auf das indische Parlament in Neu-Delhi. Der indische Besatzungsdruck verstärkte sich dadurch ebenso wie die Krisenstimmung zwischen Indien und Pakistan. Delhi warf Islamabad vor, Terroristen zu unterstützen und zu verstecken – nicht ganz ohne Grund, wie spätere Erkenntnisse nahelegen.
Pakistan entzog zwar auf Druck der USA den Terrorgruppen seine Unterstützung – wir sprechen immerhin über die Jahre nach dem 11. September 2001, als der „War on Terror“ der Amerikaner in vollem Gange war. Doch im Grenzgebiet im Kaschmir und darüber hinaus kommt es dennoch bis heute immer wieder zu neuen Anschlägen und Angriffen von Mudjaheddin-Gruppen.
Indien greift durch
2019 eskalierte die Lage erneut, als bei einem Terroranschlag im Kaschmir 44 indische Polizisten getötet wurden. Die indische Luftwaffe bombardierte daraufhin angebliche Stellungen der Terroristen auf pakistanischem Gebiet. Pakistan schoss daraufhin zwei indische Flieger ab. Wieder einmal lag Krieg in der Luft.
Indien riss erneut die direkte Kontrolle über die Region an sich, diesmal gründlich: Premierminister Narendra Modi ließ den Sonderstatus des Kaschmir aufheben und den Bundesstaat in zwei direkt der Zentralregierung unterstehenden Territorien teilen, Jammu/Kaschmir und Ladakh. Zehntausende indische Soldaten rückten in die Region ein, um Ausschreitungen zu unterdrücken. Internet und Telefon wurden abgestellt, Lokalpolitiker verhaftet. Indien hatte endgültig die Kontrolle über Kaschmir übernommen.
Ob diese Maßnahmen die gewünschte Wirkung zeigen, darf sechs Jahre später bezweifelt werden. Das Territorium Jammu/Kaschmir, der einzige mehrheitlich muslimische Unionsstaat Indiens, ist unruhig wie eh und je. Am 22. April 2025 kam es erneut zu einem Terroranschlag mit 26 Toten. Die indische Regierung beschuldigte Pakistan, die Terroristen zu unterstützen, und griff Ziele im pakistanisch kontrollierten Gebiet an. Am 10. Mai vereinbarten beide Seiten einen Waffenstillstand. Business as usual.
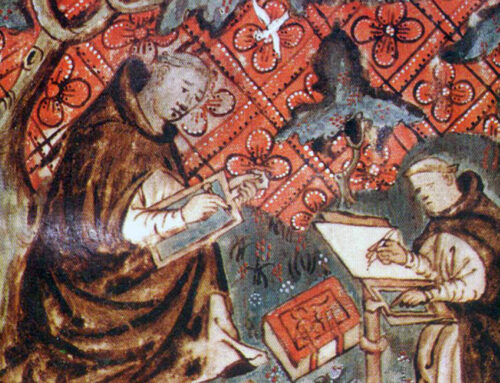
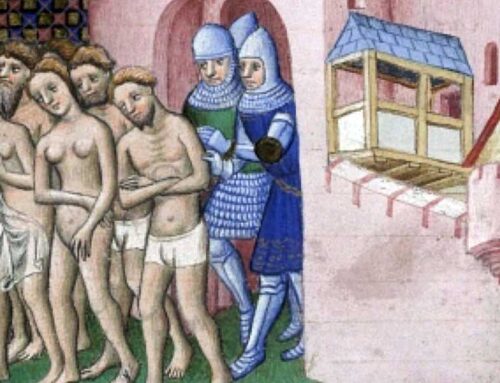

Hinterlasse einen Kommentar