Heiliges Kino – Die Filmkarriere von Jesus Christus, Superstar
von Mirko Gründer
Pünktlich zu Weihnachten besinnen sich auch ansonsten eher weltlich Eingestellte gern auf ihre Christlichkeit. Dann leistet auch alljährlich das Fernsehprogramm Buße für ein Jahr voller Völlerei und führt in zahllosen Variationen Lebens- und Leidensgeschichte von Jesus Christus vor. Der Heiland kann inzwischen auf eine beachtliche Filmkarriere zurückblicken.
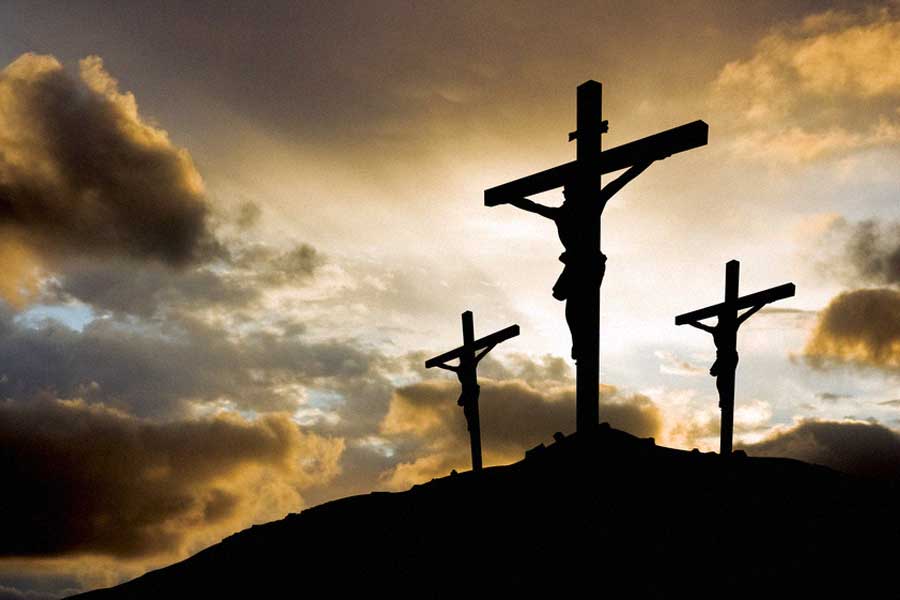
Die Filmkarriere von Jesus Christus begann schon 1897 während der Anfänge des Kinos. Bis heute war er über 360 mal in Film und Fernsehen zu sehen.
Die Kino- und TV-Präsenz von Jesus Christus ist beeindruckend. Über 360 Leinwand- und Bildschirmauftritte verzeichnet die IMDb (Internet Movie Database) bislang. Eine ähnliche Beliebtheit als Filmhelden erreichen gerade mal Sherlock Holmes (mit mehr als 260 Auftritten) und Graf Dracula (mit über 300 Auftritten), und nur Napoleon Bonaparte (mit gut 440 Auftritten) ist noch prominenter.
In derart illustrer Gesellschaft erlebte Jesus auch seine Geburt als Filmheld. Schon die Erfinder des Kinos, die Brüdern Lumière, erweckten Jesus 1897 auf der Leinwand.
Die frühen Jesusfilme hielten sich an das Schema der Passionsspiele, mit viel Pathos und den stummfilmüblichen großen Gesten, und sind heute nur noch mit viel antiquarischem Interesse zu ertragen. Dasselbe gilt für die monumentalen Stummfilmepen vom Schlag der „Ben Hur“-Verfilmungen (1907 und 1925), in denen Jesus als ätherische Nebenfigur brillierte.
Altarbilder in Technicolor
Streng genommen änderte sich wenig daran, als der Film zur Sprache fand und das Kino Theater, Oper und Kirche als beliebtester Amüsement-Ort ablöste. Beispiele aufwändiger, zunächst schwarzweiß, bald bunt verfilmten Altarbilder reichen noch bis in unsere Zeit. Die imposantesten sind zweifellos „Der König der Könige“ (1927 und 1961) und „Die größte Geschichte aller Zeiten“ (1965) – daher auch alljährlich zu Ostern und Weihnachten im Fernsehen zu bewundern. Aber auch die ZDF-Koproduktion „Jesus“ von 2000 oder Franco Zeffirellis vielstündiges „Jesus von Nazareth“ (1977) zählen in diese Kategorie.
Eine Sonderrolle in dieser Kategorie der Jesusfilme nimmt Mel Gibsons „Die Passion Christi“ (2004) ein. Von den Klassikern unterscheidet er sich nicht nur durch seinen Spleen zu historischer Akkuratesse, ein Spleen, den der christliche Fundamentalist Gibson so weit trieb, dass sämtliche Dialoge im Aramäisch und Latein des ersten Jahrhunderts gehalten werden. Er zeichnet sich auch durch eine tendenziell antisemitische Kulturkampf-Mentalität aus, die ihn zu einem der umstrittensten Filme aller Zeiten machte.
Das Problem ist der Glaube. Eine religiöse Ikone auf der Leinwand darzustellen ist gewagt – man kann ihr ein Denkmal setzen und muss dafür damit rechnen, eben nicht mehr als ein vor Pathos triefendes Altarbild zu malen. Wenn die Menschen ins Kino statt in die Kirche gehen, dann geht eben die Kirche ins Kino, und Regisseur und Schauspieler verwandeln sich in Priester und Ministranten.
Jesus Christus, der Revolutionär
Aber es gibt andere Kapitel im Buch über Jesusfilme – dunkle Kapitel, die man zu Weihnachten gewöhnlich nicht aufschlägt, weil sie auf die eine oder andere Art die Feststimmung vermiesen. Es sind Filme, die kirchlich nicht sanktionierte oder gar päpstlich verdammte Jesusbilder transportieren. Oder Filme, die Jesus dem Pathos entreißen und popularisieren. Oder gar – Gott behüte – zum Objekt von Satire machen.
So drehte Pier Paolo Pasolini 1964 sein „Das erste Evangelium“ als Antwort auf oben genannte Filmtradition. Pasolini, berühmt als einer der größten italienischen Künstler seiner Zeit, drehte in schwarz-weiß, besetzte seinen Film mit Laiendarstellern und produzierte so einen der bis heute bewegendsten Jesusfilme. Er stellte seinen Jesus dar als Mann der kleinen Leute im Kampf gegen Völlerei und Unrecht und stellte ihn damit in die sozialistische Tradition – ein Zug, der der Kirche seit den ersten Debatten über Christi Armut schwer im Magen lag. So blieb ihm die Aufnahme ins filmische Gesangsbuch versagt – ein Klassiker erster Güte ist er dennoch.
Der Mensch Jesus
Gewagter noch ist Martin Scorseses „Die letzte Versuchung Christi“ (1988), die Verfilmung eines Romans des griechischen Schriftstellers Nikos Kazantzakis. Schon das 1952 erschienene Buch hatte es auf den Index des Vatikans geschafft. Es präsentiert einen Jesus, der von Selbstzweifeln zerrissen ist. Der ein Mensch ist mit menschlichen Schwächen, der sexuelle Begierde kennt und in einer Zeit sozialer und ideologischer Kämpfe lebt. Und es zeigt einen Jesus, der nach den biblisch überlieferten Versuchungen durch den Teufel noch einer letzten Versuchung ausgesetzt wird – und ihr nachgibt, um erst nach langer Zeit auf den rechten Weg zurückzufinden. Als bekannt wurde, dass Scorsese das Skandalbuch verfilmen wollte, hagelte es in den USA Proteste und sogar Anschlagsdrohungen. Scorsese hielt es dennoch durch und legte eine passable Romanverfilmung hin – die allein schon wegen der Skandalpublicity viele Zuschauer anlockte. Existenzieller und spekulativer Gehalt gingen damals jedoch leider im Geschrei unter.

Von Jahr zu Jahr wurden die Jesusfilme authentischer. Mel Gibsons „Die Passion Christi“ wurde heftig für seine expliziten Gewaltdarstellungen kritisiert.
Scorseses Werk war aber nicht der erste gänzlich unkirchliche Jesusfilm. 1971 hatte Andrew Lloyd Webbers Musical „Jesus Christ Superstar“ Christus bereits für die Protestkultur erobert. Schon 1972 machte sich Norman Jewison an die Verfilmung des erfolgreichen Stücks. Weder Kirche noch Kirchgängern konnte dieses Stück geheuer sein, zeigte es Jesus doch als jugendlichen Rebellen gegen die Obrigkeit, voll Leidenschaft, singend und tanzend. Es zeigte Jesus als jemanden, der auch heute leben könnte, dessen Botschaft aktuell war. Das popularisierte Jesusbild brachte die Kirche in eine Zwickmühle. Aus heutiger Sicht rettete Webber das Christentum in eine weitere Generation, als Jesus zum Helden der Flower Power avancierte. Für zölibatierende und pathetische Priester und ihren Apparat und Anhang war dieser Jesus jedoch eine harte Konkurrenz…
Darf man sich über Jesus lustig machen?
Schrammten Pasolini und Webber dicht an der Blasphemie vorbei und brachte „Die letzte Versuchung“ Scorsese bis dicht vors Höllentor, so war 1979 eines klar: Die sechs britischen Komiker von Monty Python hatten ihren Platz im Fegefeuer gebucht. Sie drehten die Blasphemie-Maschinerie voll auf. Trotzdem (oder gerade deshalb) wurde „Das Leben des Brian“ zum Kultfilm schlechthin. Die beißende Satire auf die Jesusfilme der Sechziger erntete natürlich ebenfalls Schmähungen und Kritik, vor allem im prüden Amerika. Die Pythons störte es nicht. Als Satiriker kann man es nun mal nicht allen recht machen.
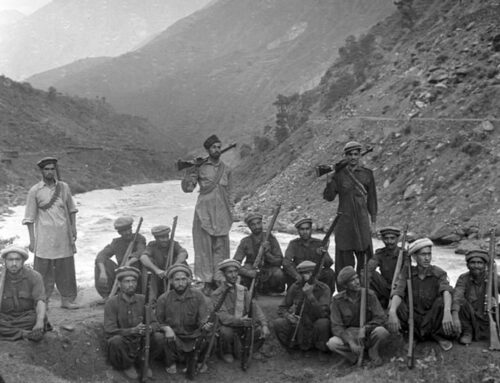
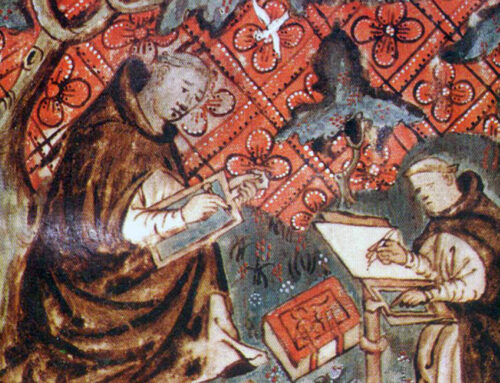
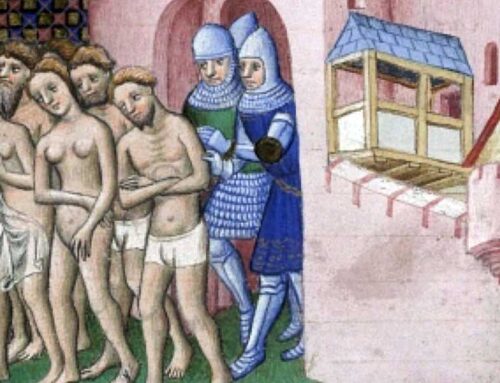
Hinterlasse einen Kommentar